weg mit den lehrstühlen!
gastbeitrag bei zeit online.
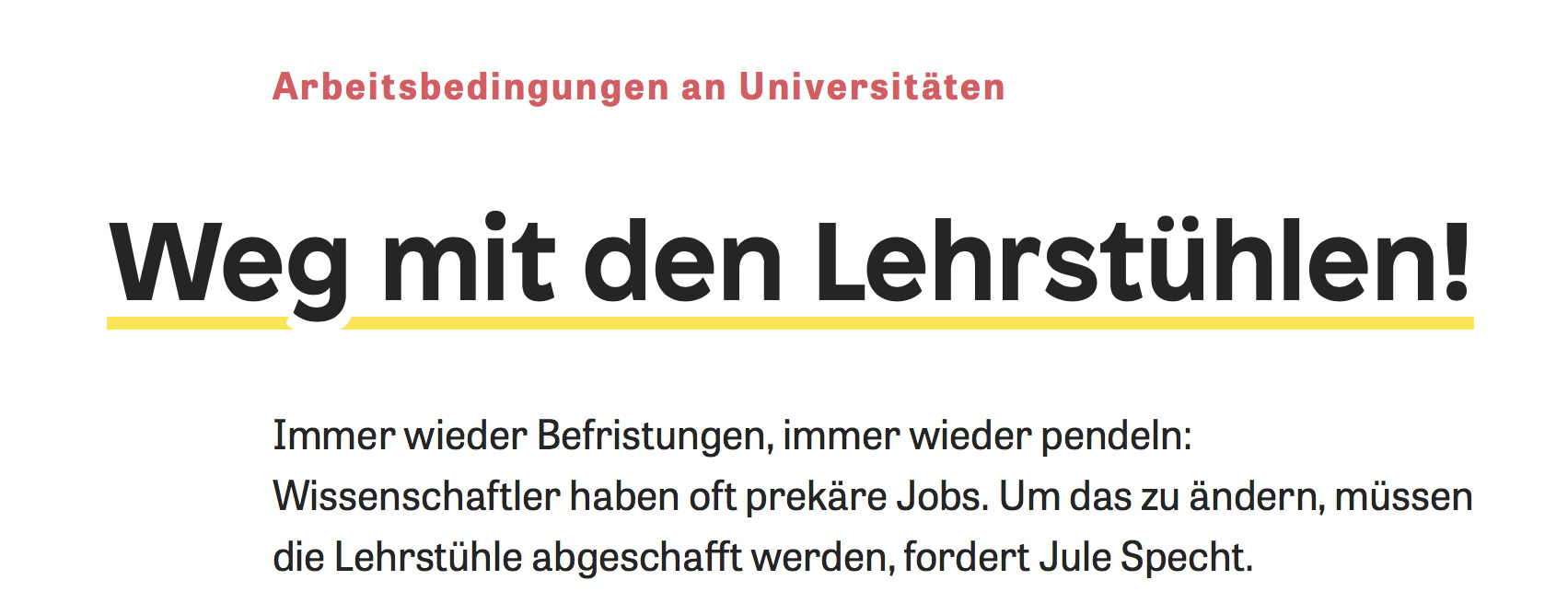
Stellen Sie sich vor: Sie arbeiten Vollzeit, bekommen aber nur eine halbe Stelle bezahlt. Nicht weil es Ihnen an Qualifikation mangelt – im Gegenteil, Sie gehören zu den am besten ausgebildeten Menschen im Land, haben studiert oder sind sogar promoviert. Sie tun das unter anderem deshalb, weil Ihr Vertrag nur noch wenige Monate läuft und die Anschlussfinanzierung ungesichert ist. Aus diesem Grund zögern Sie auch die Gründung einer Familie hinaus. Schließlich pendeln Sie wöchentlich einmal quer durch die Republik, um Partnerin oder Partner zu sehen. Seit Jahren schon. Mal in die eine, mal in eine andere Stadt. Alles in allem ist das weder eine gute Basis für Familiengründung und Work-Life-Balance noch für Muße zu guten Ideen und ambitionierten Projekten.
Was in vielen Arbeitsbereichen undenkbar scheint, ist in der Wissenschaft Alltag. Ein Beispiel: Eine Doktorandin arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin durchschnittlich um die 40 Stunden pro Woche, oftmals auf halben Stellen, und erhält dafür laut des Bundesberichts Wissenschaftlicher Nachwuchs ein Nettoeinkommen von durchschnittlich 1.261 Euro. Also etwa 7,50 Euro pro Arbeitsstunde. Auch nach der Promotion wird es oft nicht besser: immer wieder Befristungen, Jobwechsel, Pendeln, Umziehen. Außerdem sind viele Stellen inhaltlich einem Lehrstuhl untergeordnet, also keineswegs frei in Forschung und Lehre.
Planbarkeit fürs Leben, Freiheit für die Forschung
Auf diese schwierigen Bedingungen lassen sich viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein – in der Hoffnung, irgendwann eine unbefristete Stelle zu bekommen. Das Problem: Diese Jobs gibt es kaum noch. Zum einen, weil die Wissenschaft immer stärker durch Drittmittel gefördert wird: Die so finanzierten Projekte und Stellen sind so gut wie immer befristet. Zum anderen werden auch die Grundmittel, die den Universitäten langfristig zur Verfügung stehen, immer häufiger für befristete Stellen eingesetzt, zurzeit 75 Prozent davon. Die Folge: Einer gleichbleibend geringen Anzahl an Professuren steht eine steigende Anzahl an befristet beschäftigten Wissenschaftlern gegenüber. Etwa vier von fünf hoch qualifizierten Wissenschaftlerinnen gehen letztendlich leer aus – nachdem sie über viele Jahre hinweg hohe Leistung gezeigt haben und ihr Leben einem prekären Job untergeordnet haben.
So kann es nicht weitergehen. Wir müssen jungen Wissenschaftlerinnen früher Sicherheit und Planbarkeit geben und gleichzeitig mehr Freiheit für ihre Forschung und Lehre. Der Schlüssel dazu ist, wissenschaftliche Arbeit anders zu organisieren. Im bisherigen Lehrstuhlsystem kann lediglich ein Bruchteil, nämlich etwa 13 Prozent der Wissenschaftler, als Professorin oder Professor frei forschen und lehren und auf oftmals unbefristeten Stellen arbeiten. Sie sind die “Sonnenkönige” des Systems und genießen viele Privilegien. Der Rest gehört zum wissenschaftlichen Mittelbau, arbeitet also meist in Unsicherheit und Abhängigkeit von den Lehrstuhlinhaberinnen und -inhabern. Um das zu ändern, sollten wir uns von den Lehrstühlen verabschieden – zugunsten einer Departmentstruktur.
Die Rolle der Professoren verändert sich
In einer Departmentstruktur gibt es mehr Professuren und weniger Mittelbau. Zentrale Entscheidungen über Ressourcen, Einstellungen und Entfristungen liegen nicht mehr bei einzelnen Lehrstuhlinhabern, sondern sie können im Department gemeinsam getroffen werden: entweder bei regelmäßigen Treffen – oder das Department wählt demokratisch Verantwortliche für einzelne Entscheidungsbereiche.
Die wissenschaftliche Laufbahn beginnt bei einer Departmentstruktur in Graduiertenzentren. Diese Zentren, an denen die Doktorandinnen und Doktoranden promovieren, sind dem gesamten Department und nicht einzelnen Professuren zugeordnet. Als nächster Karriereschritt kann nach der Promotion eine befristete Professur folgen, die bei hervorragender Leistung in Forschung und Lehre entfristet wird – sogenannte Tenure-Track-Professuren. So entstehen früher als bisher langfristige Perspektiven. Und statt jahrelanger Wechsel zwischen unterschiedlichen Universitäten und Lehrstühlen wird die wissenschaftliche Karriere nach der Promotion auch innerhalb einer Universität möglich.
In einer Departmentstruktur ändert sich die Professorenrolle erheblich. Professorinnen sind weniger Wissenschaftsmanagerinnen als aktiv Forschende, die im engen Austausch mit den Studierenden lehren. Die zahlreichen Aufgaben bei Prüfung und Begutachtung, Betreuung und Personalführung, Transfer und Selbstverwaltung verteilen sich auf mehr Schultern, was die Professoren entlastet. Gleichzeitig werden die Kernaufgaben in Forschung und Lehre gestärkt. Davon profitieren auch die Studierenden: Sie lernen bei Menschen, die Erfahrungen in der Lehre sammeln und darauf aufbauen können, anstatt bei Dozentinnen und Dozenten, die von Semester zu Semester wechseln.
Abschaffung des Mittelbaus
Die Departmentstruktur ermöglicht, dass Wissenschaftler auf Augenhöhe und kollegial zusammenarbeiten, weil sie die alten Hierarchien aufbricht. Und spätestens seit der #MeToo-Debatte wissen wir alle: Dort, wo einige wenige Personen an der Spitze stehen, kommt es eher zu Machtmissbrauch. Das gilt in Hollywood, in Unternehmen, im Journalismus – und natürlich gilt das auch in der Wissenschaft.
Lieber weniger Stellen mit guten Arbeitsbedingungen als viele unsichere Jobs
Deshalb sollten wir das Geld im Wissenschaftssystem umverteilen. Mehr Mittel müssten in unbefristete Professuren fließen und weniger Mittel in befristete Stellen im Mittelbau. In der radikalsten Form einer Departmenstruktur würde der bisherige haushaltsfinanzierte Mittelbau nahezu vollständig abgeschafft, um damit zusätzliche Professuren zu finanzieren. Auf diesem Weg könnte die Zahl der Professuren in Deutschland fast verdreifacht werden, ohne dass dadurch das Lehrangebot eingeschränkt werden müsste. Die Anzahl der Stellen insgesamt würde dadurch sinken, die Personalmittel der Universitäten würden damit aber vollständig in Stellen investiert, die sich durch gute Arbeitsbedingungen auszeichnen.
Eine Departmentstruktur ist leistungsstark, weil Hierarchien nicht den Wettbewerb um die besten Ideen bestimmen. Und sie ist sozial verträglich, weil sie statt prekärer Beschäftigung dauerhaft in die besten Wissenschaftlerinnen investiert.
Klingt nach unrealistischer Zukunftsmusik? Keinesfalls. Eine Departmentstruktur ist international verbreitet und es gibt sie auch in Deutschland bereits bei den Wirtschaftswissenschaftlern in Bonn und Mannheim. Ein solcher Strukturwandel wird gerade in der Politikwissenschaft in Bremen vorbereitet, die Departmentstruktur ist für die gesamte neue TU Nürnberg vorgesehen und auch in der Philosophie und Medizin gibt es laute Stimmen, die das Ende der Lehrstühle zugunsten einer Departmentstruktur fordern.
Den Startschuss für einen flächendeckenden Strukturwandel könnte der Hochschulpakt – eine wichtige Einnahmequelle der Universitäten – bieten. Der einflussreiche Wissenschaftsrat forderte kürzlich, die Vergabe der Mittel dieses Hochschulpaktes an die Zahl der Professuren in Relation zu den Studierenden zu knüpfen. Dies könnte eine substanzielle finanzielle Unterstützung der Departmentstruktur bedeuten.
Die Einführung einer Departmentstruktur bedeutet einen radikalen Strukturwandel hin zu einem modernen, leistungsstarken und sozial verträglichen Wissenschaftssystem. Sie liegt keineswegs so fern, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Im Gegenteil: Eine wachsende Zahl an Wissenschaftlerinnen setzt sich intensiv mit dieser Idee auseinander oder plant bereits den Strukturwandel.
Dieser Gastbeitrag erschien am 28. August 2018 bei ZEIT ONLINE im Ressort Arbeit.
Vielen Dank für Feedback zu früheren Versionen des Textes an Juliane Frisse, Christoph Rogge, Martin Grund, Kristina Musholt und Moritz Schularick!
 jule specht.
jule specht.